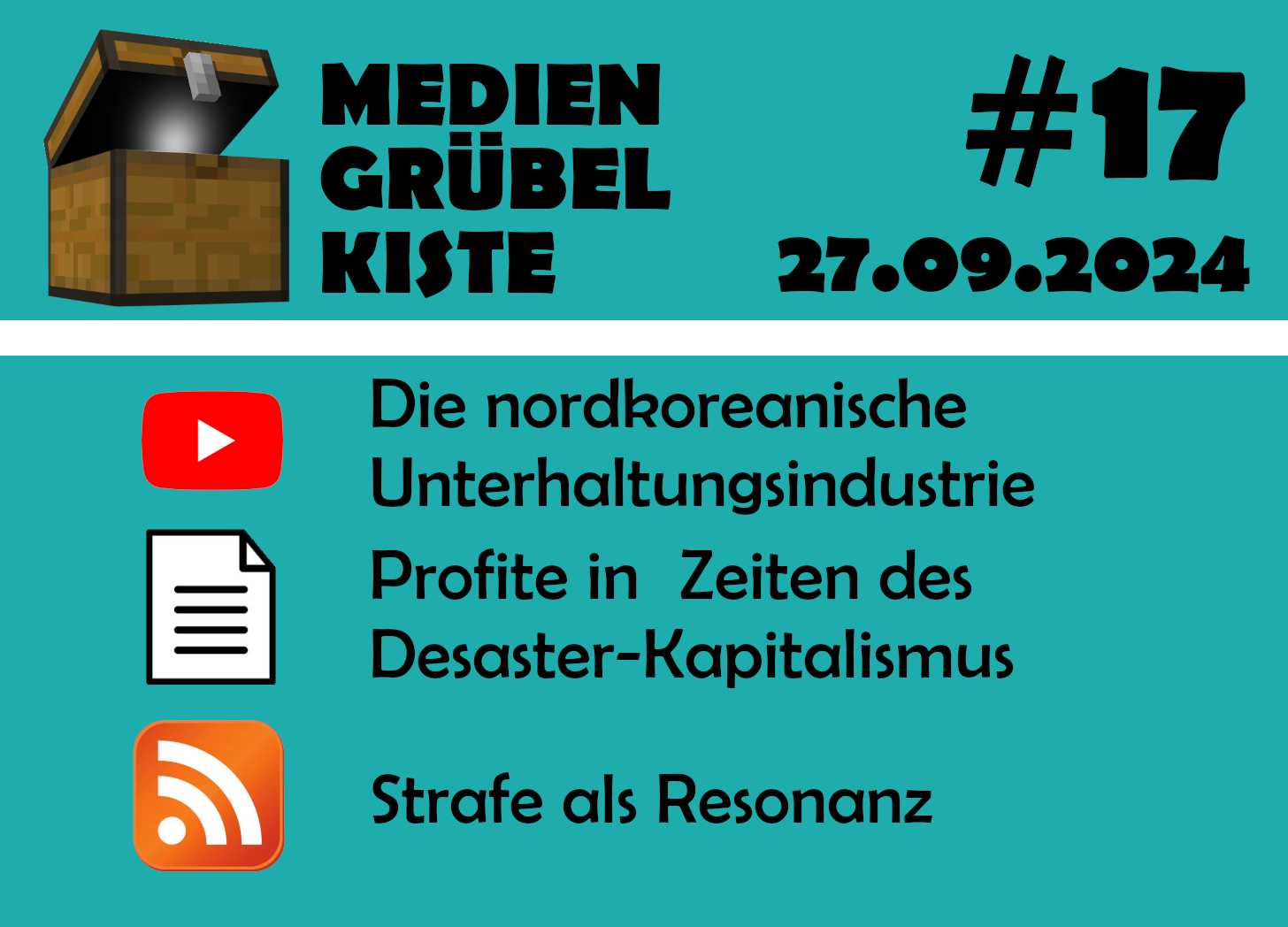Die nordkoreanische Unterhaltungsindustrie, Profite in Zeiten des Desaster-Kapitalismus, Resonanztheorie des Strafens
Diese Woche in der Grübelkiste: Ein überlanges Video-Essay über die Geschichte nordkoreanischer Unterhaltungsgüter; ein Text über Profite als Inflationstreiber und alternative Instrumente zur Bekämpfung von ökonomischen Schocks; und ein Podcast über die Resonanztheorie Hartmut Rosas als Grundlage für eine neue Legitimationstheorie des Strafrechts. Viel Spaß!
Entertainment Made By North Korea | Paper Will
Um was geht es?
Als Außenstehender betrachtet man Nordkorea stets mit einer Mischung aus Faszination und Schrecken. Nicht nur das Säbelrasseln der nordkoreanischen Führung und der faktisch andauernde Kriegszustand zwischen Nord und Süd sorgen regelmäßig für Beunruhigung, auch das Leiden der von der Welt abgeschirmten Zivilbevölkerung ist bitterer Ausdruck des ungelösten Konflikts. In diese Gemengelage aus Militarismus, Propaganda und staatlich erzeugter Paranoia stürzt sich nun YouTuber Paper Will, der mit einem fünfeinhalbstündigen Essay in beeindruckender Detailtiefe einer unheimlich spannenden Frage nachgeht: Wie sieht eigentlich die Geschichte der nordkoreanischen Unterhaltungsindustrie aus?
Was hängen blieb:
Normalerweise bin ich kein Fan von Essays dieser Länge, da mich die Fragestellung in diesem Fall allerdings besonders neugierig gemacht hat, habe ich mich an die über fünf Stunden ran gewagt – und es nicht bereut. Der Fokus des Videos liegt vor allem auf Filmen und Serien, aber auch staatliche Musikprojekte, gymnastische Großereignisse (sogenannte “mass games”) und viele weitere obskure Phänomene (etwa eine Wrestling-Veranstaltung in den 90ern mit dem Titel Collision in Korea) werden im Video beleuchtet. Die besondere Leistung von Paper Will ist es, eine Parallelgeschichte aus Unterhaltungsmedien und politischem Wandel zu erzählen, die mit der Besatzung durch Japan beginnt und bis in die Jetztzeit reicht. Die Geschichte des Landes der letzten 100 Jahre im Schnelldurchlauf auf diese Weise erzählt zu bekommen, leistet einen beeindruckenden Beitrag zum besseren Verständnis der historischen Bruchstellen, die zum heutigen Nordkorea geführt haben (etwa die Stationierung von US-Atomwaffen in Südkorea, die Kollektivierung und Zentralisierung des Bodens, der allmähliche Bruch mit der Sowjetunion und China, der Aufstieg einer brutalen Ideologie der Abschottung und Subsistenz, die Folgen von wirtschaftlichem Missmanagement, die das Wirtschaftswachstum im Vergleich zum Nachbarstaat allmählich abwürgte, die Hungersnot in den 90ern, die vorsichtigen Annäherungsversuche der südkoreanischen Sonnenscheinpolitik und die zunehmende Verschlechterung bilateraler Beziehungen in Folge des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms).
Die Entwicklungen in der Filmindustrie lassen sich wiederum nicht getrennt vom Einfluss der Propaganda- und Zensureinrichtung Nordkoreas (PAD) verstehen. Die Werke erfüllen im Grunde fast immer einen ideologischen Zweck: sei es das Schlechtreden ausländischer Lebens- und Wirtschaftsweisen, die Ikonisierung des Staatsgründers Kim Il-Sung, das Antreiben der Arbeiterschaft zur Steigerung der Produktivität, das Unterbinden von individuellen Beziehungen abseits von der Liebe zum Staat, oder die Bewerbung von Kampagnen, die den Umzug aufs Land schmackhaft machen sollten. In Summe wirken nordkoreanische Filme meist freudlos und kalt, brutal, künstlerisch mangelhaft und repetitiv. Nur in vereinzelten Momenten scheint das starre Netz der ästhetischen und ideologischen Zensur Löcher zu bekommen und der nordkoreanischen Bevölkerung einen Blick abseits der immergleichen Dogmen zu eröffnen, etwa in Filmen des entführten südkoreanischen Regisseurs Shin Sang-ok oder im 2006 erschienenen Film The Schoolgirl’s Diary.
Diese Löcher scheinen spätestens seit der Hungersnot in den 90er-Jahren immer größer zu werden: ausländische Medien kommen trotz der Gefahr von Sanktionen vermehrt ins Land, und erzeugen einen Konkurrenzdruck für die Kulturprodukte Nordkoreas, etwa im Bereich K-Pop. Während die Filmindustrie seit 2015 quasi brach liegt, wirbt Nordkorea mittlerweile im digitalen Raum mit lokalen Influencern, die das Land als glückseliges Fleckchen Erde ohne Probleme darstellen. Diese staatlichen Inszenierungen in Kombination mit der ideologischen Starre der nordkoreanischen Unterhaltungsmedien wirft zwangsläufig eine zentrale Frage auf: Wo bleibt der Humanismus? Die Annäherungen an die Menschen und ihre Probleme, an ihre Wünsche, Träume und Sehnsüchte, ihre Leidenschaften und Zwiespälte, bleibt größtenteils eine Leerstelle. Was das Essay von Paper Will aber so sehenswert macht, ist, dass er es dennoch schafft, die vereinzelten humanistischen Zwischentöne des scheinbar perfekt moderierten Staatsapparats ausfindig zu machen und hervorzuheben, etwa im Fall des japanischen Rockmusikers Funky Sueyoshi, der aufgrund besonderer Beziehung die einzigartige Gelegenheit bekam, Kindern aus nordkoreanischen Musikschulen Rockmusik nahe zu bringen. Daher nun mein Appell an euch: Wenn ihr nicht die Zeit und Lust habt, ein fünfstündiges Videoessay zu schauen – was mehr als nachvollziehbar ist – dann klickt zumindest zum Kapitel “Curtain Call” und schaut euch diese letzten fünf Minuten mit Sueyoshi und den nordkoreanischen Kids an, die für einen kurzen Moment jegliche Grenzen und Animositäten zu sprengen scheinen.
Strafe neu denken: Jenseits von Schuld und Sühne | Deutschlandfunk / Essay und Diskurs
Um was geht es?
Die Frage, wie mit Menschen umgegangen werden soll, die gegen etablierte Rechtsnormen verstoßen, beschäftigt Gesellschaften seit jeher. So schrieb Michel Foucault in Überwachen und Strafen bekannterweise über den Wandel im Strafsystem zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert, von einer körperlich zugefügten Vergeltung hin zur Disziplinierung von wünschenswertem Verhalten. Auch heute wird wieder viel über Alternativen zu existierenden Praxen des Strafens geredet, etwa wenn zynisch vom US-amerikanischen “prison-industrial complex” die Rede ist und mit Bezug auf historische Vordenker:innen wie Angela Davis die Abschaffung von Gefängnissen diskutiert wird. Aber braucht es vielleicht auch eine grundlegend neue theoretische Basis zur Legitimation des Strafens? Und wenn ja, wie könnte diese aussehen? Dieser Frage widmet sich Frauke Rostalski, die sich für ihren unkonventionellen Ansatz bei der Resonanztheorie des Soziologen Hartmut Rosa bedient.
Was hängen blieb:
Rostalski beschreibt als vorherrschende Denkschulen zur Legitimation des Bestrafens zum einen die Perspektive der Vergeltung, beziehungsweise des Ausgleichs für begangene Taten, und zum anderen eine Perspektive der Prävention, die Erziehung und Abschreckung zum Ziel hat. Beide Ansätze seien jedoch kritikwürdig und ungenügend: Ersterer, weil die Frage im Raum steht, ob eine Reaktion als Ausgleich nicht viel eher ein zweites Übel schafft, statt das erste zu vergelten; zweiterer, weil hier die Eindämmung der gesamtgesellschaftlichen “Gefährlichkeit” und die Abschreckungswirkung durch das Bestrafen stärker wiegen als das Vertrauen, dass sich Bürger kraft ihrer Vernunft für die Einhaltung des Rechts entscheiden.
Hier kommt nun das Resonanzkonzept ins Spiel, das “den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt” stellen soll. Im Kern beschreibt Hartmut Rosa in seinem Werk eine Theorie von (gelingenden oder misslingenden) Weltbeziehungen, die Anzeichen der Entfremdung oder der Resonanz aufweisen können, wobei letzteres eine Form der Offenheit für gegenseitige Beeinflussbarkeit bezeichnet. Rostalski münzt hiermit die Straftat und die Bestrafung um zu einer Form der Kommunikation zwischen Täter und Gesellschaft, beziehungsweise Täter und Opfer. Da der Täter hierbei nun selbst ein Interesse an gelingenden Weltbeziehungen habe und gleichzeitig von der Existenz des Rechts profitiere, sei die “Antwort” der Gesellschaft in Form eines “Widerspruch” (der Strafe) im Kern begrüßenswert – denn die Alternative bedeutete, dass der “Äußerung” (Tat) des Täters keine Anerkennung geschenkt werde und ein solches “stummes” Weltverhältnis den Weg der Reue von Grund auf verschließe.
Rostalski zufolge gelte dieses Verhältnis auch bei der Uneinsichtigkeit der Täter, da diese für sich nicht beanspruchen könnten, einseitig in ein “kommunikatives Verhältnis” mit einer rechtlich verfassten Gesellschaft zu treten, die dessen Status als gleichberechtigter Bürger durch die Wiederherstellung von Resonanzbeziehungen zu bestätigen versucht. Noch interessanter ist aber, dass das Verbrechen und damit der Kommunikationsakt des Täters nicht entkoppelt vom Opfer zu denken ist, welches erst durch die Bestrafung – die Ausdruck davon ist, mit dem erlittenen Leid nicht allein zu sein – in gleicher Weise wieder in eine Resonanzbeziehung gelangt.
Ich finde Rosas Resonanztheorie, trotz der berechtigten vorhandenen Kritik, durchaus faszinierend und halte den grundlegenden Gedanken von Rostalski, Tat und Bestrafung, Täter und Opfer stärker aus der Perspektive misslingender und gelingender Weltbeziehungen zu betrachten für nicht uninteressant. Trotz dieser spannenden Perspektive auf ein alternatives Legitimationskonzept bleibt für mich allerdings die Frage offen, welche Praxis des Bestrafens sich aus dieser ergeben soll. Wie weitreichend darf die “Antwort” zur Wiederherstellung von Resonanz ausfallen? Sind Gefängnisse weiterhin in Ordnung, oder braucht es andere Modelle, die dem kommunikativen Ansatz stärker Rechnung tragen? Fragen, die das Strafrecht sicherlich weiterhin beschäftigen werden.
Disaster Capitalism Revisited | The Ideas Letter
Um was geht es?
Inmitten von Pandemie, Lieferkettenengpässen, Inflation und Krieg etablierte sich in jüngster Zeit der Begriff Polykrise zur Beschreibung eines Zeitalters, in dem das krisenhafte Ereignis nicht mehr die hervorzuhebende Ausnahme von der Regel definiert, sondern vielmehr Teil eines Grundzustands unterschiedlicher, sich oftmals gegenseitig beeinflussender Verwerfungen geworden ist. Dass der politökonomische Umgang mit diesen Verwerfungen und ihren Auswirkungen für Märkte und Preisentwicklungen einen Bedarf für neue Werkzeuge und eine stärkere Fokussierung auf heterodoxe Theorieansätze miteinschließt, ist vielen Expert:innen mittlerweile bewusst. Eine solche ist auch Isabella Weber, die sich hierzulande vor allem dadurch einen Namen machte, dass sie gemeinsam mit Sebastian Dullien die Idee eines Gaspreisdeckels in die deutsche Inflationsdebatte einbrachte. Die Volkswirtschaftlerin mit China-Fokus beschäftigte sich in ihren neusten Arbeiten vor allem mit der Frage, inwiefern Marktmacht und unsichere Krisenbedingungen inflationstreibende Profitmargen zur Folge haben können. Mit dem Überbegriff “Disaster Capitalism” untersucht sie in folgendem Newsletter im Speziellen die Lage im globalen Gütertransport zur See.
Was hängen blieb:
Für einen Sozialwissenschaftler erscheint die wirtschaftswissenschaftliche Fokussierung auf eine neoklassische “Einheitslehre”, die wenig Vielfalt in alternativen Theorien und Instrumenten bietet, immer einigermaßen absurd. Die abwertenden Reaktionen von etablierten Stimmen aus dem Fach, die häufig auf Webers Arbeiten zu Preiskontrollen und “sellers‘ inflation” folgten, veranschaulichen dabei die Engstirnigkeit, die oftmals im Fach vorherrscht. Thematisch reiht sich auch dieser Text zu den genannten kontroversen Themen: Laut Weber ist die vielversprochene “Resilienz” der Wirtschaft und ihrer Lieferketten nicht umfassend zu denken ohne eine Betrachtung der Marktmacht einzelner zentraler Akteure, etwa im Bereich der Frachtschiffe.
Zwei Grundannahmen lassen sich aus dem Text als Grundlage für die Notwendigkeit von Preiskontrollen und Übergewinnbesteuerung in Zeiten der Krise extrahieren. Zum einen die Erkenntnis, dass die Möglichkeit, Profite zu erzielen für die Aufrechterhaltung marktwirtschaftlicher Verhältnisse elementar ist. Zum anderen, dass die massiven Preisanstiege in solchen Zeiten jeglichen marktwirtschaftlichen Informationswert für die Gesamtwirtschaft verlieren: Knappheiten im Angebot können trotz weiter steigender Preisen nicht zeitnah ausgeglichen werden, Nutznießer der Rekordgewinne haben keinen Anreiz, ihr Geschäftsmodell gegen zukünftige Krisen zu wappnen und Endverbraucher zahlen horrende Preise für oftmals notwendige Güter. Um individuelle und gesellschaftliche ökonomische Interessen also gleichermaßen zu bewahren, seien beide Instrumente unumgänglich.
Webers Fokus auf Frachtschiffe hebt das skizzierte Problem in besonderer Weise hervor. Lediglich acht Reedereien seien mittlerweile für mehr als 80% des globalen kommerziellen Schiffverkehrs zuständig. Die zeitweisen Engpässe, die sich durch die Pandemie und den Krieg in der Ukraine ergaben, sorgten bei diesen Reedereien für Rekordprofite. Durch das Aufkommen neuer Krisenherde (Gazakrieg, Angriffe der Houthi im Roten Meer, Dürren im Panamakanal) ließen sich diese Profite auch trotz steigender Inflation weiter durchsetzen. Anhand eigener Aussagen der Reederei Maersk lässt sich zudem festhalten, dass in solchen konzentrierten Marktsituationen eine Rationierung stattfindet, um langjährige Kunden zu privilegieren.
Als zentrale Erkenntnis für Entscheidungsträger:innen ergibt sich für Weber, dass die Bekämpfung einer Inflation, die sich aus solchen Krisen ergibt, mit dem herkömmlichen Mittel der Zinserhöhung nicht effektiv machbar ist:
“Water is not flowing back into the drought-ridden Panama canal in response to price signals. Wars don’t stop because freight rates shoot up.”
Preiskontrollen und Steuern auf “windfall profits” ermöglichen es, pragmatisch auf Schocks zu reagieren, in denen Märkte versagen, statt sich ins ideologische Schneckenhaus des Dogmatismus zu verkriechen. Auch wenn weitere Forschung zur profitgetriebenen Inflation sicher noch aussteht, lässt sich festhalten, dass die Marktkonzentration in zentralen Dreh- und Angelpunkten unserer gesellschaftlichen Infrastruktur seinen Teil zur krisenhaften Dynamik beisteuert. Auch die vermutete Monopolstellung großer Internetkonzerne steht zunehmend im Fokus von gerichtlichen Auseinandersetzungen. Neben Webers Vorschlägen zur Krisenbewältigung bedarf es somit auch das selbstbewusste Auftreten der Kartellbehörden, um unsere gemeinsame Zukunft nicht nur gemäß wirtschaftlicher, sondern auch gemäß demokratischer Standards zu gestalten.
Eine Kiste bunt Gemischtes: