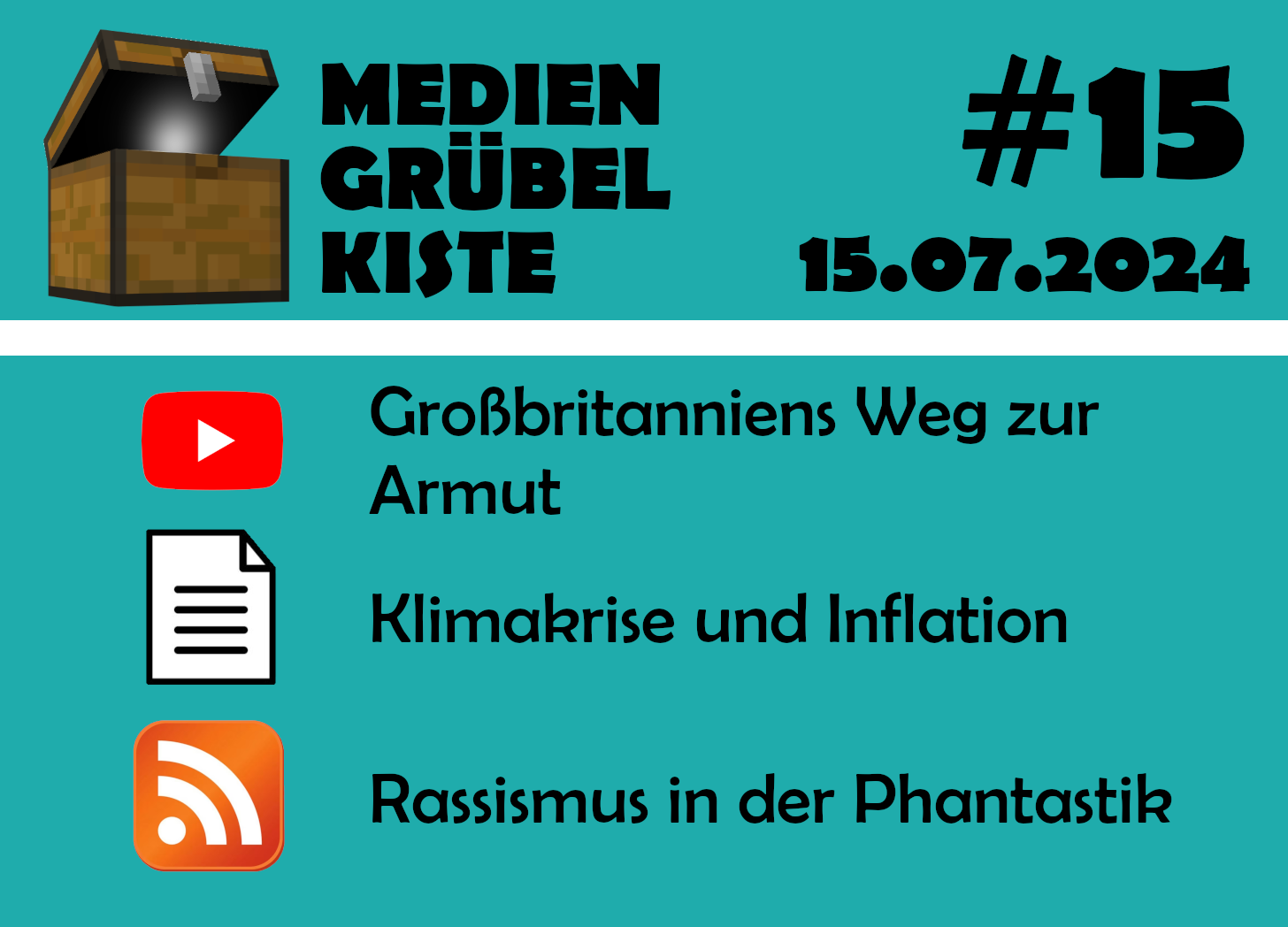Großbritanniens Weg zur Armut, Lebensmittelinflation in Folge der Klimakrise und Rassismus in der Phantastik
Diese Woche in der Grübelkiste: Ein ausführliches Video über die letzten 14 Jahre konservativer Politik in Großbritannien; ein Bericht über die Auswirkungen der Klimakrise auf die Preisentwicklung im Lebensmittelsektor; und ein Radio-Feature über die Rolle von Rassismus in Fantasy- und Science-Fiction-Erzählungen.
How Britain Became a Poor Country | Tom Nicholas
Um was geht es?
Die Briten haben gewählt und nach 14 Jahren konservativer Herrschaft erstmals wieder Labour zu einer Mehrheit verholfen. Die Erwartungen an Premierminister Keir Starmer sind nun ebenso groß wie die Probleme, die er erbt: Die Armut ist auf Rekordniveau, der Ausverkauf staatlicher Infrastruktur zeigt zunehmend seine Schattenseiten und die Perspektivlosigkeit sitzt tief. Nach vielen holprigen politischen Jahren ist es mitunter gar nicht mehr so einfach, den Weg nachzuzeichnen, der zu diesem Punkt geführt hat. Genau dieser Aufgabe verschreibt sich YouTube-Essayist Tom Nicholas, der mit Hilfe zahlreicher Statistiken und detaillierten Nachzeichnungen der politischen Abläufe die Frage beantwortet, wie genau Großbritannien eigentlich arm wurde.
Was hängen blieb:
Nicholas’ Dreiakt-Struktur – bestehend aus den staatlichen Einschnitten unter David Cameron, dem Brexit-Fiasko und der Politik rund um die Pandemie – fügt die Masse an vereinzelten Polit-Ereignissen zu einem klar verständlichen Bild mit roten Fäden zusammen. Einen davon bildet etwa der Siegeszug einer Austeritätspolitik, die mit Hilfe des Duktus, es sei kein Geld vorhanden, erst Dinge wie den endgültigen Ausverkauf der Royal Mail mit sich brachte, und dann, durch den Abbau staatlicher Leistungen, die Armutslast zunehmend auf lokale Tafeln verschoben hat. Dass dieser Ausverkauf des Wohlfahrtstaats begleitet wurde vom Slogan “We are all in this together”, erinnert auf unangenehme an die hiesigen Zugeständnisse an die Austeritätsforderungen der FDP durch die SPD und Scholz’ Versprechen “You’ll never walk alone”.
Ein weiterer interessanter roter Faden im Video ist der interne Wandel der konservativen Partei: Laut Nicholas‘ seien zum Zeitpunkt von Liz Truss’ umstrittener Steuerreform sozialliberal eingestellte Parteimitglieder beinahe vollständig von weit rechts oder libertär eingestellten Mitgliedern verdrängt worden. Abschließend zeigt sich auch in der Zahnlosigkeit des aktuellen Labour-Manifestos, wie sehr sich der Austeritätsdiskurs und die Angst vor weiteren Unruhen auf dem Anleihenmarkt auch über Parteigrenzen hinweg verfestigt hat. Ob hier in den nächsten Jahren noch der Mut gefunden werden kann, um den massiven Armutsproblemen im Land entgegenzuwirken, bleibt abzuwarten.
“After 14 years in power, more than 100 billion pounds in cuts to Public Services, one Brexit referendum, countless, corrupt covid PPE deals and a self-inflicted economic crisis, the consequences of conservative governance are plain for all to see.”
Climate change is pushing up food prices — and worrying central banks | FT
Um was geht es?
Die Nachwehen der Pandemie und die Kaskadeneffekte durch Russlands Angriffskrieg in der Ukraine haben in den letzten Jahren weltweit zu steigenden Energiepreisen und sektorenübergreifenden Preissprüngen gesorgt. Während die spezifische Zusammensetzung der Inflation aus Nachfrage-, Angebots- und Profitgründen in der VWL weiterhin ergründet wird – in der Hoffnung, daraus Präventionsangebote für die Zukunft ableiten zu können – bahnt sich in der Gestalt der Klimakrise eine weitere Hürde für das langfristige Inflationsmanagement an. Global gesehen könnte allein durch die erwarteten Temperaturerhöhungen ein Anstieg von mehr als 3 Prozent für Nahrungsmittel innerhalb des nächsten Jahrzehnts drohen. In einem ausführlichen und differenzierten Text für die Financial Times widmet sich Susannah Savage dem Thema und beleuchtet mitunter die Frage, wie die Politik in diesem Kontext reagieren sollte.
Was hängen blieb:
Der Text steckt voller interessanter globaler Betrachtungen der Verbindungen zwischen lokalen Auswirkungen der Klimakrise und den daraus resultierenden Planungsschwierigkeiten, Missernten und Preisanstiegen. Während diese Effekte ehemals als singuläre Ereignisse betrachtet wurden, gelte es nun, sie als permanente Faktoren mit einzukalkulieren. Auch innerhalb der Zentralbanken, die in vielen Ländern Lebensmittel- und Energiepreise bisher nicht in ihre Berechnung der Kerninflation inkludieren, wird zunehmend diskutiert, inwiefern die Geldpolitik mit Zinserhöhungen auf eine durch Nahrungsmittelpreise getriebene Inflationen reagieren sollte. Die global steigenden Temperaturen sorgen wiederum nicht nur dafür, dass weitere technische Hilfsmittel, etwa zur Bewässerung, von Nöten sind, sondern hat logischerweise auch einen Einfluss auf die menschlich eingesetzte Arbeitskraft, die für die Verwertung der Natur notwendig ist (ein spannendes Schema für eben solche Dynamiken zwischen Mensch und Natur in der aktuellen Zeit findet sich beispielsweise in Simon Schaupps empfehlenswerten Buch Stoffwechselpolitik).
Wichtig hervorzuheben ist zudem die Erkenntnis, dass diese Preissteigerungseffekte in Ländern des globalen Südens und für soziostrukturell schwächere Haushalte umso stärker auftreten. So besteht der Preis für Brot in Ländern mit niedrigen oder mittleren Einkommen zu bis zu 70% aus den Kosten für Weizen, während Arbeits-, Energie- und Transportkosten in Ländern mit hohen Einkommen diesen Anteil auf bis zu 10% drücken. Gleichzeitig macht der Anteil der Lebensmittelkosten für Haushalte in Entwicklungsländern bis zu 50% der Gesamtausgaben aus, was im Falle von Preisschocks eine umso stärkere individuelle Inflationsrate bedeutet. Zusätzlich seien Inflationserwartungen überdurchschnittlich stark an Lebensmittelkosten gekoppelt. Angesichts dieser neuen Konstellation von Problemen wird der Ruf nach unorthodoxen Lösungen größer: So fordert etwa die Ökonomin Isabella Weber, die schon als Ideengeberin für die hiesige Gaspreisbremse auftrat, die Rolle von großen Unternehmen und deren Marktmacht für die Inflationsentwicklungen stärker in den Blick zu nehmen. Mit Blick auf die Klimakrise schlägt Weber zusätzlich das Anlegen von Reserven für Grundnahrungsmittel an, um Preisfluktuationen ausgleichen zu können, sowie gezielte Übergewinnsteuern für relevante Sektoren.
Rassismus in Fantasy und Science Fiction | Deutschlandfunk/Feature
Um was geht es?
Simplifizierende Kontraste, etwa der Kampf “Gut gegen Böse”, bilden einen zentralen Kern vieler Fantasy und Science-Fiction-Erzählungen. In der Skizzierung fremder Nationen und Lebensformen entpuppt sich die Kategorisierung und Stereotypisierung von Gruppen als ein gängiges Mittel, um Identifizierung und Wiedererkennbarkeit innerhalb des eigenen Worldbuildings herzustellen. Immer häufiger wird nun allerdings kritisch hervorgehoben, dass eine solche Verflachung ganzer fiktiver Völker die Gefahr birgt, zum Schauplatz für realweltliche Rassismen zu werden. Christoph Spittler hat sich dem Thema für den Deutschlandfunk angenommen und berichtet von historischen Ursprüngen und aktuellen Entwicklungen zum Thema Rassismus in der Phantastik.
Was hängen blieb:
Als biologischer Determinismus wird in diesem Feature die strenge Kopplung von Charaktereigenschaften und Abstammung bezeichnet – ein weit verbreiteter Wesenszug einiger Fantasy und Science-Fiction-Geschichten, der sich gerade in Mainstream-Titeln wiederfindet. So werden im originalen Der Herr der Ringe die ent-individualisierten Orks mit dem “absoluten Bösen” in Verbindung gebracht und als Chiffre für das Wilde und kulturell Minderwertige genutzt (die Bezeichnung des Feindes als “Ork” findet sich aktuell etwa im Fall des Ukraine-Kriegs). Die Stereotype, die hier angewandt werden, sorgen für kognitive Entlastung und entspannten Eskapismus. Die Reaktionen auf den Hinweis, dass dieser Umstand potentiell auch problematische Züge in sich trägt, könnten unterschiedlicher nicht ausfallen: Während kritische Ansätze etwa im unkonventionellen Ausspielen von Klischeerollen in Dungeons & Dragons-Runden erprobt werden, sehnen sich andere nicht nur die Rückkehr zu früheren Regelsystemen, sondern auch die Verlässlichkeit einstmals etablierter Rollen zurück – in der Fiktion ebenso wie im echten Leben. Der Phantastik-Diskurs wird somit ein weiterer Schauplatz kultureller Kämpfe, zwischen reaktionärem Verlangen und Versuchen der kritischen Neuformulierung.
Eine Kiste bunt Gemischtes: