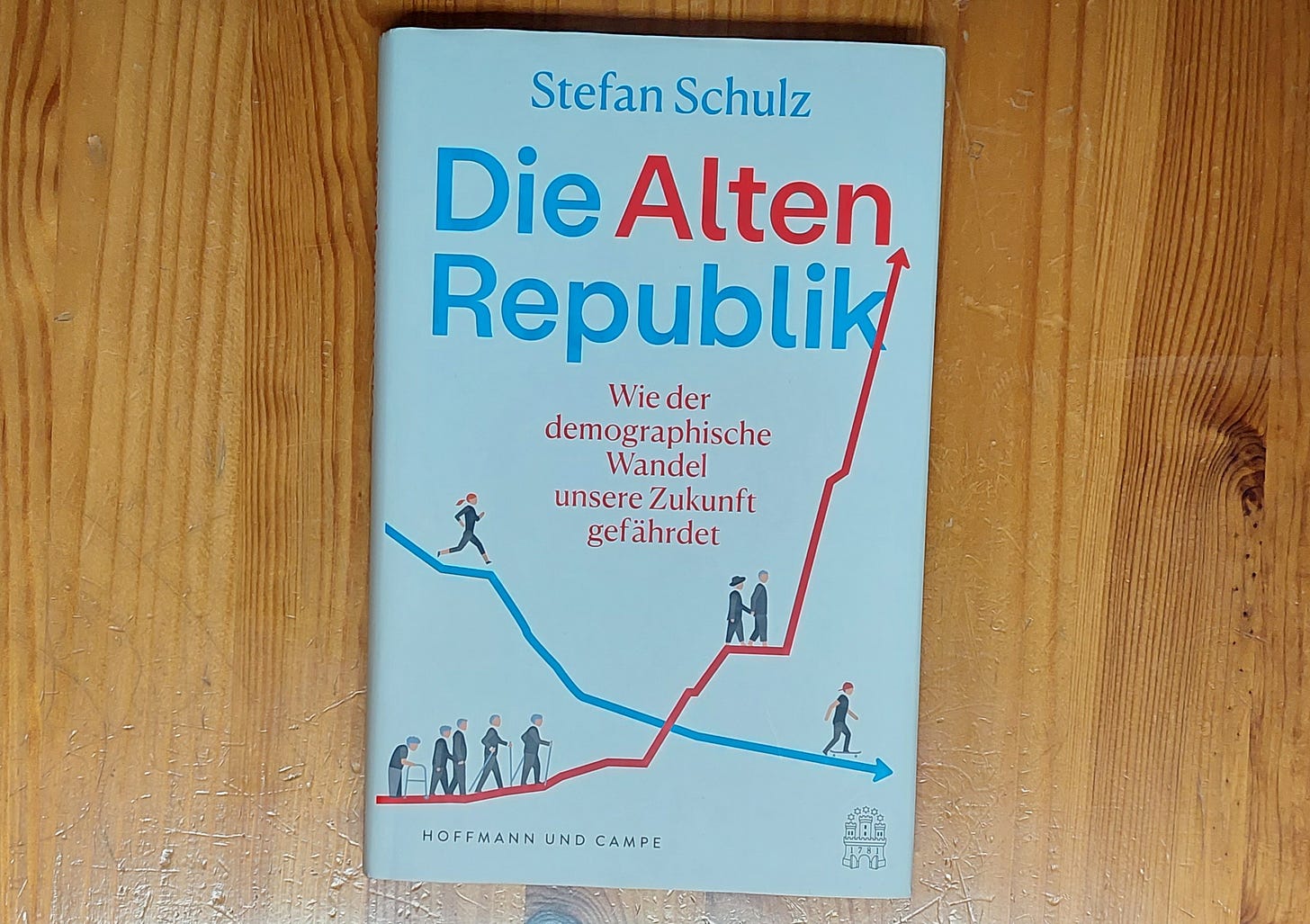Iran und die Medien, Wasserknappheit, Nachruf auf Bruno Latour und Die Altenrepublik
Diese Woche in der Grübelkiste: Ein Interview mit der ehemaligen Leiterin des ARD-Studios in Teheran zu den Protesten im Iran, eine Recherche zu den Hintergründen der Wasserknappheit im Zuge des Klimawandels, ein Nachruf auf Bruno Latour und eine Besprechung des Buches “Die Altenrepublik” von Stefan Schulz
Wieso wird so wenig über die Iran-Proteste berichtet? | Übermedien
Um was geht es?
Die Journalistin Natalie Amiri hat nicht nur selbst iranische Wurzeln, sondern war von 2015 bis 2020 auch Leiterin des ARD-Studios in Teheran. Sie weiß daher bestens über die seit drei Wochen andauernden landesweiten Demonstrationen und die Brutalität, mit der das Regime diesen begegnet Bescheid. Im Interview mit Holger Klein spricht sie über die Probleme der journalistischen Arbeit im Inland, aber auch über das scheinbare mediale Desinteresse im Ausland, sowie die schleppende Solidarisierung und politische Zahnlosigkeit.
Was hängen blieb:
Normale journalistische Arbeit ist im Iran aufgrund der strikten Vorgaben des Landes beinahe unmöglich, was jedoch nicht den Mangel an Reflektionen zur Situation im Iran in den hiesigen Medien entschuldigt, so Amiri. Der Modus des Ausnahmezustands oder der Krise in der vorhandenen Berichterstattung schade zudem der Bewegung, die eigentlich im Lichte eines möglichen positiven Neuanfangs dargestellt gehöre. Doch muss man aus dem Gespräch auch schlussfolgern, dass die Langfristigkeit dieser Rebellion am seidenen Faden hängt: Wer rüstet diese aus, wenn sich das Regime des Ajatollahs Chamenei nicht gewaltlos geschlagen gibt? Welchen Einfluss hätte ein Misserfolg auf den Aufbruchswillen der jungen Bevölkerung?
Nehmen Tesla, BASF & Co. uns das Wasser weg? | VOLLBILD
Um was geht es?
Durch den Klimawandel wird Wasser zum unkalkulierbaren und damit knappen Gut. Darunter leiden Landwirtschaft, unsere Wälder, aber auch zunehmend regionale Privathaushalte, die in dürren Phasen bereits zum Wassersparen angemahnt werden. Gleichzeitig profitieren wasserhungrige Privatunternehmen wie BASF von Verträgen, die ihnen das günstige Abpumpen natürlicher Wasserquellen erlauben. Wie reagiert die Politik auf dieses Problem? Der Recherche-Kanal VOLLBILD nimmt sich dem Thema an.
Was hängen blieb:
Wasserknappheit rückt wie der Klimawandel nicht nur näher, sondern ist bereits unangenehme Realität, wie uns der diesjährige Sommer erneut schmerzhaft vor Augen führte. Der Beitrag bietet eine Reise durch die Problemstellen im Land, vom Landwirt bis zum Waldschützer, hin zu den bereits betroffenen Privathaushalten und engagierten Journalisten, die zu den teils schwierig einsehbaren Wasserverbrauchen von Firmen wie BASF recherchieren. Eine zentrale Erkenntnis: Wasser wird falsch bepreist. Dass Haushalte bereits Einsparungsvorgaben bekommen, Privatunternehmen aber noch ungestört und staatlich rabattiert das Mangelprobleme vergrößern dürfen, ist sozial ungerecht und ein Problem, das dringend politisch angegangen werden müsste.
Der Paradigmenwechsler | ZEIT
Um was geht es?
Der französische Soziologe und Wissenschaftsphilosoph Bruno Latour ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Welchen Eindruck hat er in der Wissenschaftswelt hinterlassen, wie sieht sein Vermächtnis aus und wie hilft uns das Denken, das er hinterließ, in der aktuellen Krise der Wissenschaftskommunikation? Ein Nachruf von Tobias Haberkorn.
Was hängen blieb:
Bruno Latour ist ein Name, der mir im Studium immer mal wieder am Rande begegnete, mit dem ich mich aber nie tiefergehend befasst habe. Die Akteur-Netzwerk-Theorie (als Beschreibung des Zusammenspiels von menschlichen und nichtmenschlichen Handlungsträgern) war mir ein Begriff, seine Erweiterung einer Erkenntnistheorie des Konstruktivismus, die über den linguistic turn hinausgeht und die Interaktion mit der nichtmenschlichen Umwelt miteinschließt, vage bekannt. Dieser exzellente Nachruf allerdings hat in mir ein großes Interesse geweckt, mal den ein oder andern Text von Latour selbst in die Hand zu nehmen. Denn mit seinem Verständnis einer Wissenschaft, die nicht nur als diskursive Einbahnstraße kommuniziert, sondern auch performativ und transparent handelt, die Erkenntnis und Politik als sich gegenseitig bedingende Bestandteile eines Experimentierfelds begreift, scheint er ein für unsere Zeit überaus fruchtvolles Gedankengebäude hinterlassen zu haben.
100 Wörter (oder so) über: „Die Altenrepublik“ von Stefan Schulz
Liest man ein Buch, das im Titel verspricht, sich mit den Belangen der Ältesten im Land auseinanderzusetzen, gibt es eine Reihe von Themen, die man intuitiv erwarten würde: Darunter Rente, Pflege, Einsamkeit, sowie der Umgang mit dem Abschiednehmen. Viele dieser intuitiv erwartbaren Themen tauchen in „Die Altenrepublik“ zentral auf, doch ist die Protagonistin des Buches nicht die Politik des Altwerdens selbst, sondern die Demographie als eigene Akteurin, die uns zwingt, auf die von ihr geschaffenen Probleme zu reagieren; was jahrzehntelang versäumt wurde, wie hier überdeutlich festgehalten wird. Somit geht es im Buch von Stefan Schulz um vieles mehr: Die Familie im 21. Jahrhundert, die Ökonomie hinter dem Kinderwunsch, ideale Fertilitätsraten, mangelnde Geselligkeit, demokratietheoretische Problemstellungen im Zeitalter zunehmender Überalterung – und immer wieder auch um die Frage, welche Rolle eine sozial (und nicht nur leistungs-) gerechte Umverteilungspolitik bei diesen Probleme spielen müsste. Das Buch strotzt vor Statistiken und ist daher oft ein wenig sprunghaft in der Kapitelführung, und ein wenig zu kurz kommt zudem die Verdichtung der Lösungsvorschläge. Die breite Perspektive von „Die Altenrepublik“, die von neurowissenschaftlichen Erkenntnissen über die Smartphone-Sozialität bis hin zum empirischen Aufdröseln unserer Familienpolitik reicht, macht das Buch allerdings unter dem Strich – und vor allem generationenübergreifend – sehr lesenswert und liefert einige Denkanstöße über Versäumnisse und Chancen unserer demographischen Vergangenheit und Zukunft.