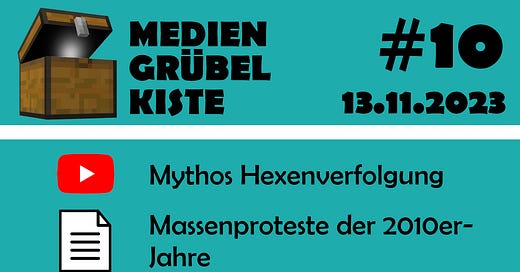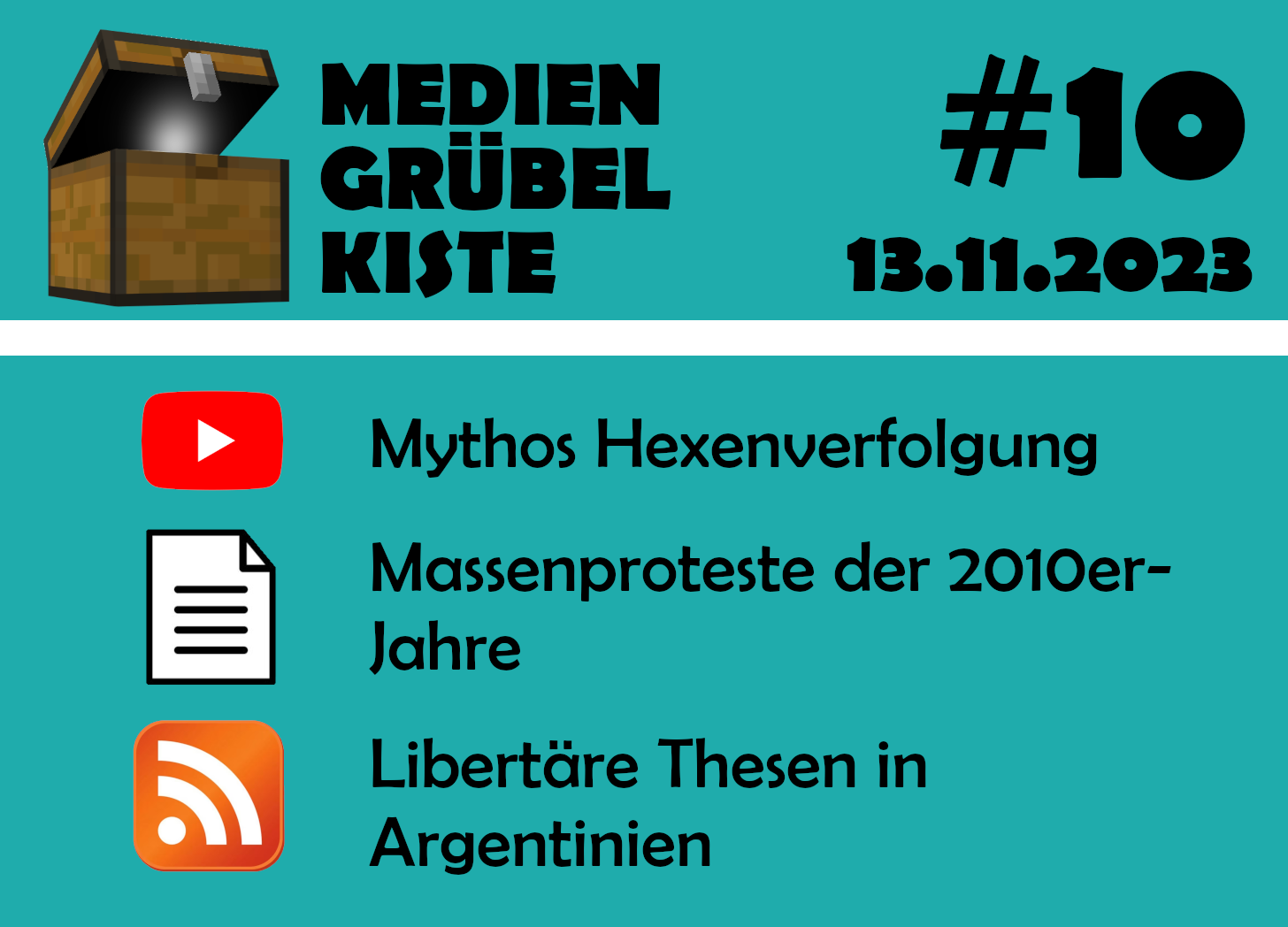Mythen der Hexenverfolgung, globale Protestbewegungen der 2010er und libertärer Radikalismus im argentinischen Wahlkampf
Diese Woche in der Grübelkiste: Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Mythos der Hexenverfolgung im Mittelalter; ein längerer Text über das utopische Momentum der Graswurzelbewegungen der 2010er und die Frage, was mit diesem geschehen ist; und ein Podcast über die libertären radikalen Thesen des argentinischen Präsidentschaftskandidaten Javier Milei.
Debunking the Pervasive Myths About Medieval Witch Hunts | Kaz Rowe
Um was geht es?
Von all den populären (und mittlerweile in der Wissenschaft stark kritisierten) Bildern zum ‚düsteren Mittelalter‘ zählt die Jagd auf Hexen zweifellos zu den verbreitetsten und wirkmächtigsten. Die Idee einer massenhaften Verfolgung von Frauen, die mit unorthodoxen kulturellen Praktiken aus den patriarchalen Strukturen einer ‚voraufgeklärten‘ Zeit herausstachen und dafür im Feuer ihren Tod fanden, klingt intuitiv geradezu plausibel; zumindest, bis man sich die historische Faktenlage genauer ansieht. Der Kanal Kaz Rowe hat dies getan und ordnet dabei zugleich Verbindungen zu modernen Aneignungen des Hexen-Mythos auf sozialen Plattformen genauer ein.
Was hängen blieb:
Neben der generellen Einordnung des Hexen-Mythos anhand genauer Quellenarbeit und Rekonstruktion der populären (und fehlgeleiteten) Geschichtsschreibung zum Thema, war für mich vor allem die erwähnte Verbindung zwischen Hexerei und Ausprägungen eines radikalen Feminismus eine gänzlich neue, faszinierende, bisweilen aber auch beunruhigende (etwa in der Parallelisierung von angeblichen Massenmorden an Frauen, die heidnische Bräuche praktizierten, mit den Opfern des Holocaust). Erwähnenswert sind zudem die gelegentlichen Kommentare, dass tatsächliche Fälle von Hexenverfolgungen häufiger noch in der Zeit der Renaissance zu finden seien, woran sich auch die im Video aufgemachte These anschließen lässt, dass Geschichtsschreibung oftmals einem ‚Fortschritts-Bias‘ aufsitzt, dem die negative Abwertung der Vorzeit als Legitimation und relative Aufwertung gegenwärtiger Zustände dient.
The mass protest decade: why did the street movements of the 2010s fail? | The Guardian
Um was geht es?
Eingeläutet durch die revolutionären Demonstrationen in Tunesien waren die 2010er-Jahre geprägt vom Glauben an die utopische Kraft der Graswurzelbewegungen. Für einen kurzen Moment schienen Machthierarchien fragil – Autokraten sowie die zentralen Institutionen des globalen Kapitals wirkten verletzlich und formbar, eine andere Welt rückte in den Rahmen des Möglichen. Doch dann verpuffte ein Großteil dieser revolutionären Energien und was folgte war vielerorts eine Rückbewegung zugunsten autoritärer, islamistischer und populistischer Mächte. Was war geschehen? Mit dieser Frage im Kopf befragte Vincent Bevins für den Guardian knapp 200 Menschen, die an den globalen Protesten beteiligt waren, im Versuch, eine Antwort zu finden.
Was hängen blieb:
Ein einigermaßen langer, multiperspektivischer Text, mit dem großen Anspruch, eine globalgültige These zum Verbleib des utopischen Potentials der Graswurzelbewegungen zu formulieren, der meiner Ansicht nach auch spannendes zur Frage beizutragen hat. So scheint über alle Bewegungen hinweg die Einsicht zu herrschen, dass ausgerechnet die ‚Horizontalität‘ der Macht, die sich durch ein nie dagewesenes Mobilisierungspotential im Zeitalter digitaler Medien entfaltete, die langfristige Übernahme von politischer Kontrolle erschwert zu haben. Die ‚Strukturlosigkeit‘ der Massen überrumpelte zwar durch ihre schiere Größe die etablierten Machtstrukturen, erzeugte dadurch aber häufig ein Vakuum, dass durch besser (‘vertikal’) organisierte Akteure mit oftmals schlechteren Absichten gefüllt wurde, statt von den revolutionären Protestlern. Ableiten lässt sich hieraus, dass die generelle Skepsis vor (hierarchisch strukturierter) politischer Repräsentation auch der kühnsten und edelsten revolutionären Bewegung womöglich eher schadet als hilft: „If the existing elites can actually be removed […] then some group must be prepared to take their place and do a better job”.
Ep. 218: Der Aufstieg des Javier Milei – wieso Argentinien einen Anarchokapitalisten wählt | Wohlstand für Alle
Um was geht es?
Ende Oktober fand in Argentinien eine hierzulande medial wenig beachtete Präsidentschaftswahl zwischen dem amtierenden Wirtschaftsminister Sergio Massa und dem Populisten Javier Milei statt, die nun am 19. November in die Stichwahl geht. Obwohl Milei trotz erfolgreicher Umfragen in der ersten Runde unterlag, droht mit der immer noch möglichen Wahl Mileis Drastisches, wirft man einen Blick auf die Thesen und Forderungen des libertären Ökonomen. Der Podcast Wohlstand für Alle widmet sich Mileis Politik und ordnet diese kritisch ein.
Was hängen blieb:
Von Populisten, aus Nord- sowie aus Südamerika, sind wir ja mittlerweile einiges gewöhnt, und dennoch wirken die libertären, anarcho-kapitalistischen Thesen Mileis beunruhigend und destruktiv. Das wirtschaftlich gebeutelte Argentinien, das in den 50er-Jahren noch zu den reichsten Ländern gehörte, hängt aktuell hochverschuldet am Tropf internationaler Geldgeber; eine Situation, die prädestiniert für explosiven politischen Defätismus scheint. Mit seinem Ziel eines schlanken und wirtschaftlich untätigen Staates wirkt Milei wie eine radikalere Version Hayeks, während seine populistische Forderung, die Zentralbank zu sprengen Bitcoiner zu Freudensprüngen verleiten dürfte. Seine autoritären, anti-progressiven Forderungen, das Abtreibungsrecht abzuschaffen und auch andere kulturelle Fortschritte rückgängig zu machen, unterstreichen die Gefahr, die von Milei ausgeht.
Zur aktuellen Situation in Israel und Palästina gibt es hier nun noch eine nicht weiter kommentierte Linksammlung mit Texten, die in meinem Feed aufgetaucht sind und mir erwähnenswert erschienen:
“Was gesagt werden muss” (Beatrice Frasl)
“The Decolonization Narrative Is Dangerous and False” (Simon Sebag Montefiore)
“Wir, die Linken? Nicht mehr” (Eva Illouz)
“Hausgemachte Probleme” (Eberhard Seidel)
“Der Antisemitismus der Progressiven” (Ulrich Gutmair)
“Das Schweigen vor dem ABER” (Navid Kermani)
“Israels Regierung hat versagt – das ist die Alternative” (Tom Würdemann)