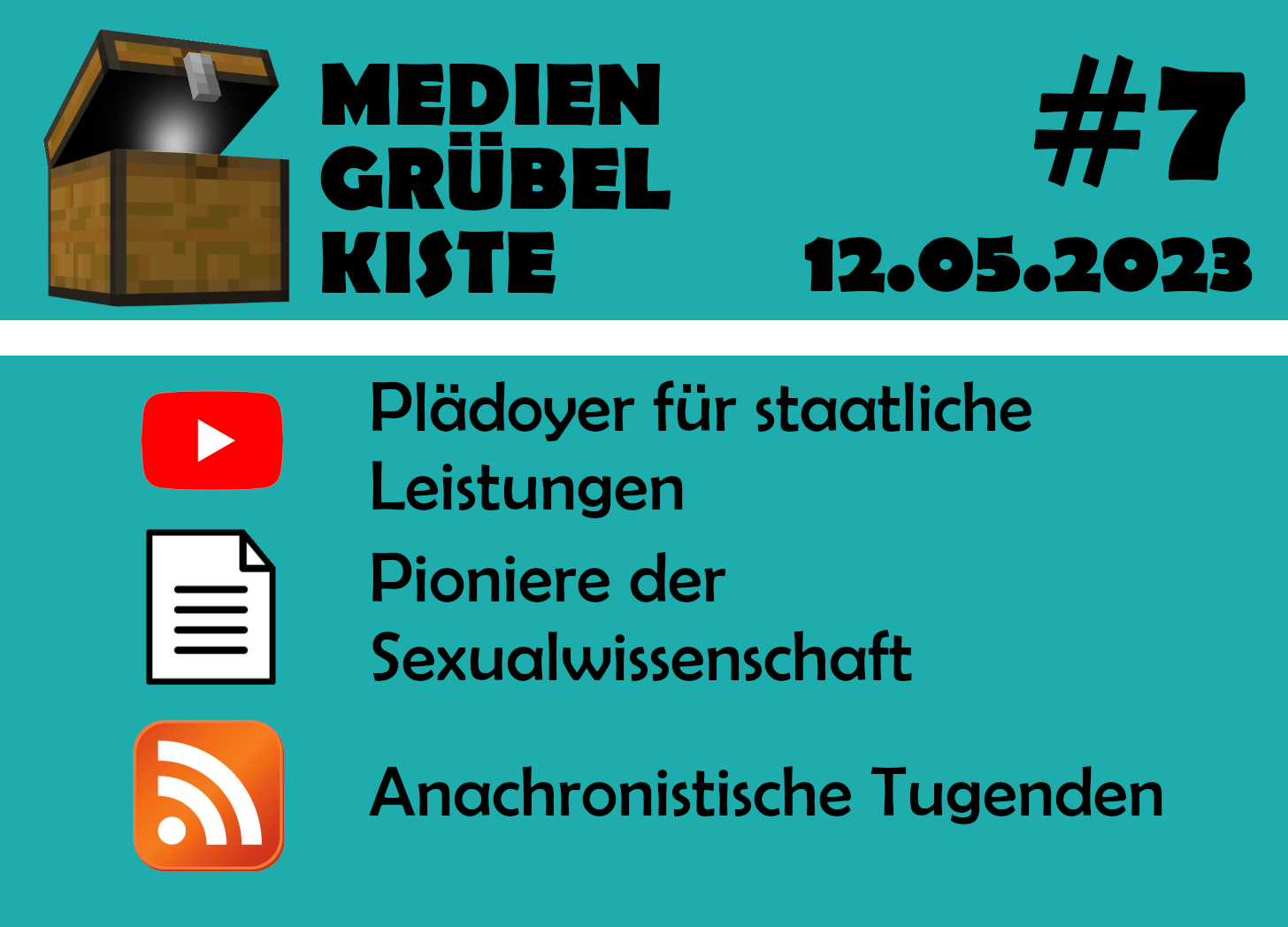Plädoyer für staatliche Leistungen, anachronistische Tugenden und Pioniere der Sexualwissenschaft
Diese Woche in der Grübelkiste: Ein langes Videoessay über die positiven Externalitäten von sozialen Leistungen und Sicherungsystemen; ein Podcast über die Frage, inwiefern “altbackene”, anachronistische Tugenden und Lebensweisen anknüpfbar sind für die heutige Zeit; und ein Text über das Institut für Sexualwissenschaft, das im Berlin der 1920er Jahre Pionierarbeit leistete und zu den Opfern der nationalsozialistischen Bücherverbrennung zählte.
Free Stuff is Good, Actually | Unlearning Economics
Um was geht es?
Gegen Sozialsysteme zu hetzen, gehört zum “guten Ton” des (wirtschafts-)konservativen bis rechtsgerichteten Populismus. Dabei dienen vor allem gesäte Zweifel zur Finanzierbarkeit und geschürte Ängste über den Wegfall von Arbeitsanreizen als Grundlage dafür, dem Volk Sparzwang und Austerität unterzujubeln, und die Privatisierung von gesellschaftlichen Institutionen voranzutreiben. Obwohl der Diskurs zum Thema stark von diesen lautstarken Stimmen geprägt ist, offenbart der Blick in die Empirie der Sozialleistungen ein gänzlich anderes Bild. Der Kanal Unlearning Economics hat einige Fakten zusammengetragen und präsentiert damit ein Plädoyer für leistungslose staatliche Sicherungssysteme.
Was hängen blieb:
Das Video bietet eine Reihe von überzeugenden Argumenten für den Ausbau von Sozialsystemen, vor allem im Bereich Gesundheit und Bildung, und vor allem in Bezug auf Niedriglohnländer und -haushalte. Das Argument des Ökonomen Milton Friedman, dass es so etwas wie ein „free lunch“ nicht geben könne, also keine Leistung, der nicht eine „Vorleistung“ vorausgeht, wird innerhalb des Videos nachvollziehbar auseinandergenommen; durch verhältnismäßig geringe Kosten der staatlichen Sicherung und Förderung werden positive Externalitäten losgetreten, die insgesamt zu glücklicheren und gesünderen Menschen mit weniger Problemen und Kosten führen. Auch diskutiert wird die Einführung eines universellen Grundeinkommens, da sich dieses in den bisherigen, begrenzten Testläufen als überwiegend positive sozialpolitische Maßnahme herausgestellt hat.
Gibt es unzeitgemäße Ideale und Gefühle? | Deutschlandfunk/Essay und Diskurs
Um was geht es?
Gerade aus linker Perspektive birgt die Rückbesinnung auf das Vergangene, auf dessen Lebensweisen, Traditionen und Tugenden, schnell mal die Gefahr, der nostalgischen Verklärung und einer reaktionären Denkweise bezichtigt zu werden. Im Interview mit dem Philosophen Martin Scherer geht Essay und Diskurs der Frage nach, inwiefern eingestaubte Ideale und Lebensgefühle wie Edelmut, Takt, Großherzigkeit oder Hingabe für unsere Moderne fruchtbar gemacht werden können, ohne den Populismus der Ewiggestrigen zu bedienen.
Was hängen blieb:
Ein wirklich spannendes Thema, über das ich mir in dieser Form noch nicht wirklich viele Gedanken gemacht habe. Scherer ist es für seine Arbeit wichtig, zwischen der Figur des Reaktionärs und der des Anachronisten zu unterscheiden; Ersterer ist ein verklärter Nachahmer des Vergangenen, während Letzterer versucht, das Unzeitgemäße kreativ in die Gegenwart zu holen. In der Orientierung an Tugenden, die beispielsweise historisch mit der Figur des „Gentleman“ verknüpft waren, versucht Scherer für eine Theorie und Praxis der Lebenskunst zu werben, die der heutigen Überstrapazierung des authentischen und identitätsbewussten Ichs eine Kultur der taktvollen Distanz gegenüberstellt. Dadurch sollen Gefahren für die Verwundbarkeit und Verletzlichkeit, die durch unseren Umgang miteinander heutzutage oftmals verstärkt werden, abgemildert und die Sensibilität für gegenseitige Vorsicht und Vermittlung gefördert werden.
Pionier der Sexualwissenschaft: Als die Nazis das Institut von Magnus Hirschfeld zerstörten | Tagesspiegel
Um was geht es?
Am 10.5. jährte sich zum 90. Mal die Bücherverbrennung der Nationalsozialisten, die im Jahr 1933 sämtliche Werke von Autor:innen zerstörten, die in der völkischen Ideologie der Faschisten keinen Platz finden sollten. Dazu zählten vor allem jüdische Autor:innen, aber auch andere Schriftsteller:innen unliebsamer politischer Gesinnungen. Weniger bekannt ist allerdings, dass auch Texte zur frühen Forschung von Geschlecht und Sexualität den Taten der Nazis zum Opfer fielen. Diese fanden sich im Berlin der 1920er Jahre vor allem im Institut für Sexualwissenschaft, das von Magnus Hirschfeld gegründet wurde und zu den Pionieren seiner Zeit gehörte. Alice Ahlers fasst die Geschichte des Instituts für den Tagesspiegel zusammen.
Was hängen blieb:
Die historische Aufarbeitung von Hirschfeld und dem Institut für Sexualwissenschaft scheint mir in der heutigen Zeit von besonderer Relevanz zu sein. Zum einen scheint es mir sehr wichtig, diesen wenig beleuchteten Aspekt deutscher Geschichte stärker in das Kollektivbewusstsein zu transportieren, da er unterstreicht, in welcher langen Tradition queeres Selbstverständnis und Forschung zur Geschlechtlichkeit stehen. Zum anderen zeigen sich gerade mit Blick auf die heutigen 20er Jahre erschreckende Parallelen: Damals wie heute wagten sich marginalisierte Menschen in die Öffentlichkeit, die für eine progressive und enttabuisierende Geschlechterpraxis kämpften; und damals wie heute sehen wir, wie rechte Propagandisten auf alles Nicht-Normative anspringen und den geschlechtlichen Kulturkampf zum Teil ihres politischen Programms machen.