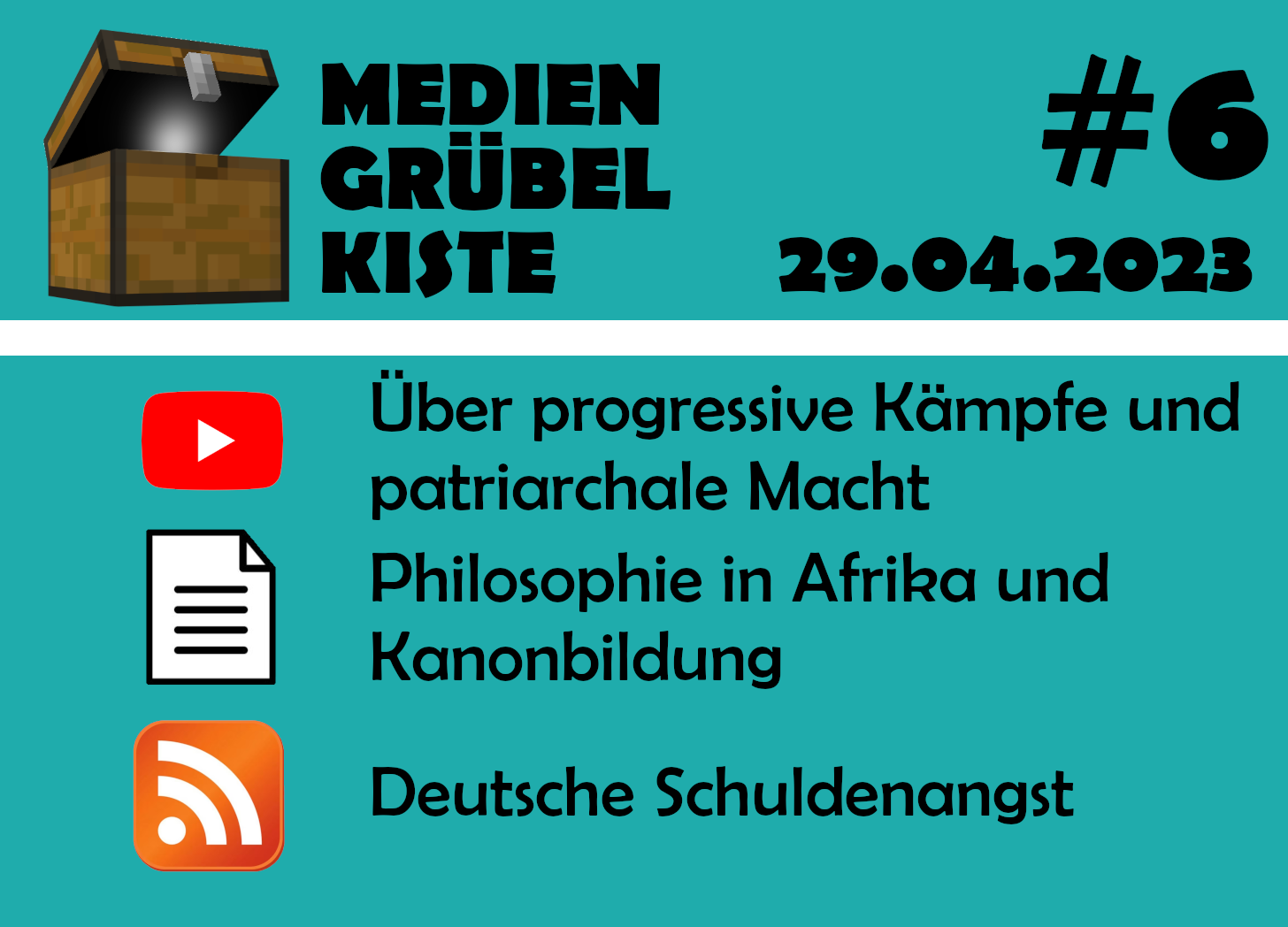Progressive Kämpfe und das Patriarchat, afrikanische Philosophie und die deutsche Schuldenangst
Diese Woche in der Grübelkiste: Ein langes Videoessay über die perfiden Diskurstaktiken von J.K. Rowling, über den progressiven Kampf um die Ausdehnung des egalitären common sense und das Wirken patriarchaler Kräfte; ein Interview über afrikanische Philosophie und die Erweiterung des Kanons der Philosophiegeschichte; und ein Podcast über deutsche Fiskalregeln und die Schuldenbremse.
The Witch Trials of J.K. Rowling | ContraPoints
Um was geht es?
Vor zwei Monaten schrieb ich hier bereits über die Transfeindlichkeit von J.K. Rowling und die Kontroverse, die sich rund um die Frage entwickelt hatte, ob es noch legitim sei, den neu erschienenen Titel Hogwarts Legacy zu spielen. Einen der besten Diskursbeiträge zu Rowlings Fanatismus allgemein lieferte 2020 die YouTuberin ContraPoints in Form eines Videos, in dem Versuch unternommen wurde, die Geisteshaltung der Harry Potter-Autorin nachzuvollziehen und eine Erklärung für ihre politische Radikalisierung zu finden. Nun meldet sich ContraPoints mit einem weiteren Video über Rowling zurück, in dem ein neuer Podcast mit dem nichts Gutes verheißenden Titel „The Witch Trials of J.K. Rowling“ als Ausgangspunkt dient, um neurechte Argumentationsweisen zu dekonstruieren und ein Verständnis für die Funktionsweise von Kämpfen für gesellschaftlichen Fortschritt zu schaffen.
Was hängen blieb:
Indem sie Rowlings Transfeindlichkeit mit der Figur Anita Bryant kontrastiert, einer US-amerikanischen, kulturkonservativen Gegnerin der Gleichberechtigung von Homosexuellen aus den 70er-Jahren, bietet ContraPoints einen faszinierenden Blick auf die formale Deckungsgleichheit der Argumentationsschemata der kulturellen (und religiösen) Rechten von damals und heute. Hierzu zählt vor allem die Selbstinszenierung als ein nach Gleichberechtigung strebendes Mitglied der Gesellschaft, das dem Kampf für soziale Anerkennung von Minderheiten unter dem Vorwand einer „berechtigen Kritik“ aber letztendlich die Legitimität abzusprechen versucht, da die spezifisch vorliegende Minderheitendiskriminierung in Wahrheit bereits konzeptuell nicht anerkannt wird. Im Zuge ihres fast zwei Stunden langen Videos stellt ContraPoints nachvollziehbar dar, dass er progressive Kampf über unseren geteilten „common sense“ immer schon durchzogen war von aktivistischen Momenten des Tabubruchs und der Transgression; von all dem, was bürgerliche Kritiken, zu denen man die Äußerungen von Rowling und Konsorten zu einem gewissen Grad zählen kann, häufig als „illiberal“ abstempeln. Über ihre Verbindung von ideologiekritischer Analyse und empathischer Nachempfindung der Emotionswelt der kritisierten Personen gelingt es ContraPoints zudem, eine mögliche Erklärung dafür anzubieten, wieso immer wieder (vorgeblich feministische) Frauen in den rechtskonservativen bis faschistoiden Strudel der (im Kern patriarchalen) Kulturkämpfe geraten.
Was zeichnet Philosophie aus Afrika aus, Frau Graneß? | Philosophie Magazin
Um was geht es?
Wer an einer deutschsprachigen Universität einen Kurs zur Einführung in die Philosophie und ihre Geschichte besucht, der wird einem im Kern häufig ähnlichen Curriculum begegnen: Europäisch orientiert, mit Startpunkt irgendwo in der antiken griechischen Vorsokratik, mit zentralen Figuren wie Hegel oder Kant und deren systematisch aufgebauten Gedankengebäuden. Häufig außen vor bleiben hier nicht-europäische philosophische Einflüsse und Traditionen, beispielsweise aus Japan, China, Indien, oder Afrika. Im Gespräch mit dem Philosophie Magazin erläutert Anke Graneß, Herausgeberin des jüngst erschienenen Suhrkamp-Bands Philosophie in Afrika in welchem Verhältnis besagter Kontinent sowie andere aus dem Kanon ausgeschlossenen Traditionen zur Philosophiegeschichte und zum philosophischen Denken stehen.
Was hängen blieb:
Ein spannendes Interview, das einen Blick auf die historische Herausbildung des akademischen Kanons wirft und diese Entwicklung nachvollziehbar in Beziehung setzt zum ethnisch-kulturellen Überlegenheitsdenken, das dem Rassismus als Ideologie den Weg ebnete. Spannend ist hierbei, dass Graneß zufolge Philosophiegeschichten vor Beginn des 19. Jahrhunderts noch stärker „diversifiziert“ waren (und Bezug nahmen auf hebräische, ägyptische, äthiopische oder chinesische Traditionen) und erst der stärkere Einfluss der Naturwissenschaften, des Logik- und Rationalitätsbegriffs, sowie der individualisierten Zuschreibung von Autorenschaft zu einem historischen Bruch führte, infolgedessen ein linear orientiertes Entwicklungsmodell des Geistes etabliert wurde. Mit Blick auf afrikanische Traditionen wünscht sich Graneß, dass auch ältere Schrifttraditionen sowie orale Überlieferungen ohne eindeutig identifizierbare Autorenschaft kritisch und intersektional in die Forschung aufgenommen werden.
The New Germany: German Schuldenangst | History & Politics Podcast/Körber-Stiftung
Um was geht es?
Drei Jahre lang setzte die Bundesregierung im Zuge der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine die Schuldenbremse aus und stellte in Form von Sondervermögen abseits vom üblichen Staatshaushalt zusätzliche Gelder zur Bewältigung der Krisen bereit. Damit soll, wenn es nach Finanzminister Christian Lindner geht, nun Schluss sein – die wachsende Zinslast sei zunehmend untragbar, fiskalische Verantwortung müsse wieder hergestellt werden, die Schuldenbremse solle wieder eingehalten werden. Schuldenangst und fiskalische Zurückhaltung, das sind in der deutschen Politik tief verwurzelte Allgemeinplätze. Der Podcast History & Politics der Körber-Stiftung widmet sich zusammen mit Expertin Philippa Sigl-Glöckner den Hintergründen zur deutschen Fiskalpolitik und stellt Überlegungen dazu auf, wie ein tragbares und zukunftstaugliches Modell zum Schuldenmachen aussehen könnte.
Was hängen blieb:
Philippa Sigl-Glöckler ist für mich eine der interessantesten Stimmen zu den Problemen der deutschen Schuldenregeln, und auch in diesem Interview lassen sich einige spannende Gedanken zur aktuellen Debatte ableiten. So erwähnt sie beispielsweise die Gefahren für die angewandten Ausnahmeregelungen der Schuldenbremse, die durch ein bevorstehendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts drohen könnten, sowie das „schizophrene“ Auseinanderklaffen zwischen außergewöhnlich hohen krisenbedingt bereitgemachten Summen und der strukturellen Unterfinanzierung für langfristige Investitionen. Trotz aller Probleme der deutschen Schuldenbremse sieht Sigl-Glöckler in der Auflösung der Regelung akut keine Lösung, sondern empfiehlt stattdessen eine Neuberechnung der Grundlagen, die für die Bewertung von Neuverschuldungen bisher herangezogen werden.