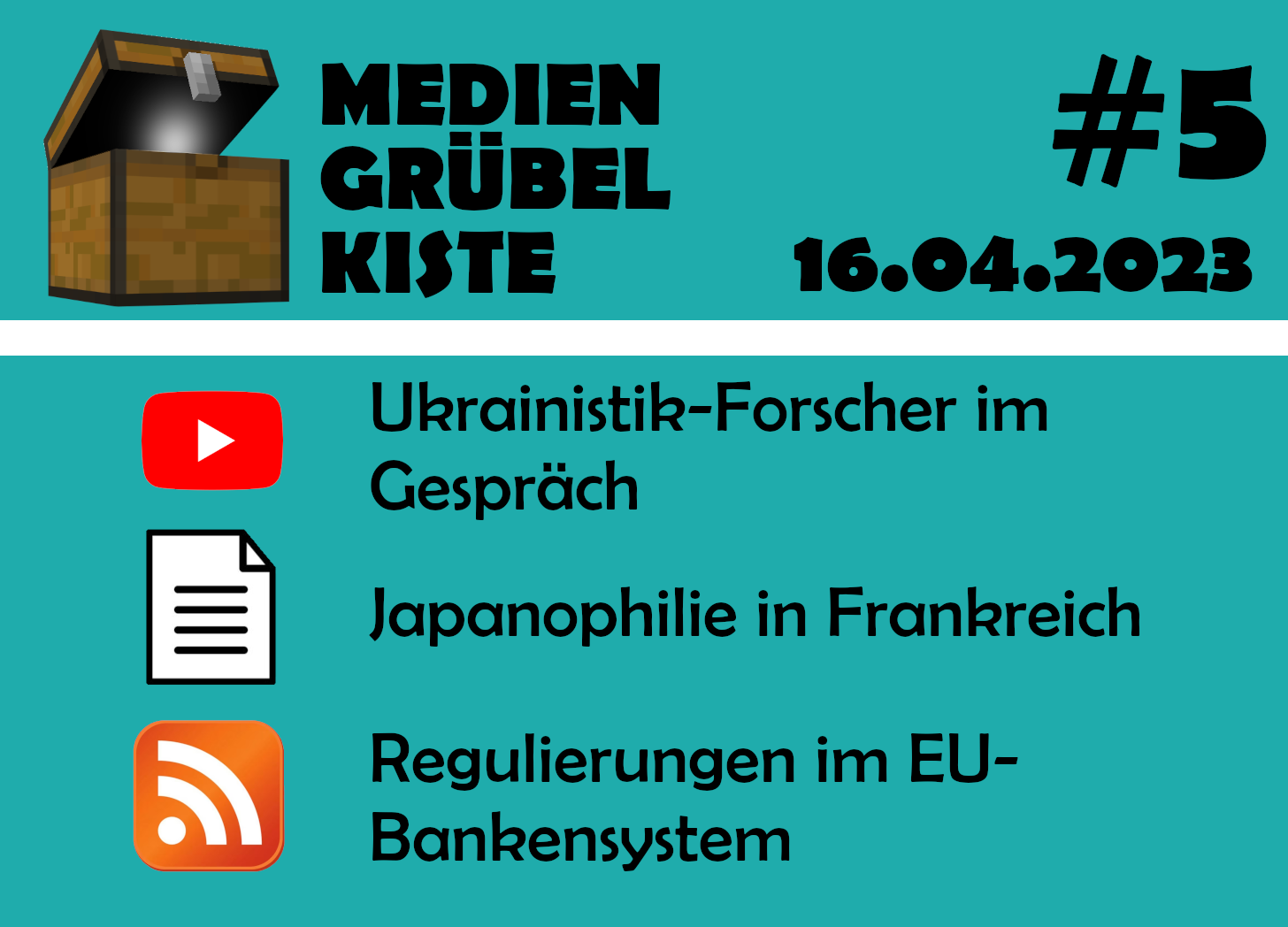Ukrainistik-Forscher im Gespräch, die Krisenfestigkeit des EU-Bankensystems und popkulturelle Japanophilie in Frankreich
Diese Woche in der Grübelkiste: Ein Interview mit Roman Dubasevych, einem Ukrainistik-Forscher, der faszinierende Gedanken zur ukrainischen Geschichte und Kultur, sowie über historische Verflechtung mit Russland beisteuert, und Überlegungen für die Möglichkeiten zur Überwindungen des Krieges und seiner inhärenten Konflikte aufstellt; ein Podcast über die kürzlichen Bankenkrisen in den USA und der Schweiz, über den Ausbau von Regulierungsystemen seit 2007 und die Krisenfestigkeit der EU-Banken; und ein Artikel über die Geschichte der französischen Affinität zur japanischen Popkultur.
Ukrainistik-Professor Roman Dubasevych über den Krieg & die Geschichte | Jung & Naiv
Um was geht es?
Das Zeitalter der Krise, in dem wir uns seit einigen Jahren befinden, nährt das Verlangen nach Expertenwissen. Dieses Verlangen kann aufklärerische Prozesse voranbringen; man denke an den Erfolg des Corona-Podcasts mit Christian Drosten des NDR. Die Verunsicherung der Menschen, die dieses Verlangen nach klaren Wahrheiten antreibt, kann aber auch dazu führen, dass Gruppenzugehörigkeiten und festgefahrene Denkmuster einer rationalen Auseinandersetzung vorgezogen werden, wie sich mit Blick auf aktuelle verschwörungsideologische Dynamiken beobachten lässt. Auch in Bezug auf den Krieg in der Ukraine spielt das Prestige des Expertenwissens immer wieder eine große Rolle: Militärexperten, die eine schnelle Niederlage der Ukraine prophezeiten, mussten schnell ihre Einschätzungen korrigieren, währenddes die aktuellen Debatten von stark polarisierenden Überlegungen zu Waffenlieferungen und Verhandlungsoptionen durchzogen sind, die häufig Eindeutigkeit versprechen, wo eigentlich nur graue Unberechenbarkeit herrscht. Der jüngste Gast im Interview-Format des Kanals Jung & Naiv ist zwar auch ein Experte, aber in vielen Belangen ein außergewöhnlicher, wie ich mit dieser Empfehlung festhalten möchte. In knapp vier Stunden spricht der Ukrainistik-Forscher Roman Dubasevych über kulturelle Wurzeln und Verflechtungen der Ukraine, über die Hoffnungen der Menschen des osteuropäischen Staates, über historische Schattenseiten und über den Traum eines Auswegs aus der aktuellen Katastrophe.
Was hängen blieb:
Faszinierend an diesem Gespräch war für mich zum einen die überlegte Ausdrucksweise von Dubasevych, sowie der ihm ansehbare Schmerz, den scheinbar auch die intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Krieg, der russisch-ukrainischen Vorgeschichte und den Möglichkeiten eines menschenwürdigen Endes des Konflikts mit sich bringt. Zum anderen – und um damit einen Bogen zum oben angerissenen Exkurs zum Thema Expertenwissen zu schlagen – war für mich der Debattenbeitrag, der mit diesem Gespräch geliefert wurde, ein inspirierender und zutiefst nachdenklich machender. Zwischen einseitigen militaristischen Lösungsansätzen, die in die Wirkmacht des Heroismus vertrauen, und den propagandistischen Aberkennungen des Selbstverteidigungsrechts der Ukraine von Leuten wie Wagenknecht, eröffnet das Denken von Dubasevych einen humanistischen dritten Weg, der den Menschen und die Hoffnung auf eine friedliche Entwicklung der ukrainischen gesellschaftlichen Institutionen in den Mittelpunkt stellt.
Neue Bankenpleiten: Wie krisenfest sind Europas Banken? | EU to go / Jacques Delors Centre
Um was geht es?
Die kürzlichen Bankenkrisen der US-amerikanischen SVB und der Schweizer Credit Suisse haben erste Zweifel gesät, ob es sich hierbei nicht nur um Beispiele einzelner Fehlentscheidungen und Unglücksfälle handelte, sondern um eine sich anbahnende systemische Krise, die die Folgen des Krieges, der Inflation und der Zinserhöhungen westlicher Zentralbanken im Gepäck hat. Gerade nach der Finanzkrise 2007 lautet die drängendste Frage: Ist unser europäisches und internationales Bankensystem gut genug gesichert? Welcher Änderungen bedarf es immer noch? Thu Nguyen und Sebastian Mack vom Podcast EU to go widmen sich den aktuellen Entwicklungen zum Thema.
Was hängen blieb:
Für einen ökonomisch ungebildeten aber (vor allem aus sozialwissenschaftlicher Perspektive) interessierten Beobachter der Wirtschaft wie mich bietet der Podcast einen überschaubaren, aber prägnanten Überblick zu den Entwicklungen internationaler Richtlinien seit der Finanzkrise 2007, sowie zu den aktuellen Plänen einer EU-Bankenunion. Interessant sind hier im Detail vor allem scheinbar stattfindende Debatten zur Frage, wie entstehende Schäden unter Einlegern und Bankenbetreibern verteilt werden sollen. Während für die Abwicklung von Bankenpleiten diese zwar selbst stärker in Haft genommen werden sollen, steht weiterhin in Frage, ob und in welchem Umfang eine europäische Einlagensicherung Gestalt annehmen und damit systemische Unsicherheiten mildern könnte.
Manga-nifique! How France became obsessed with Japanese anime | The Guardian
Um was geht es?
Japanische Popkultur ist für viele Menschen im Westen ein kultureller Dauerbrenner, ein Einblick in einen ästhetischen und erzählerischen Exotismus, der übliche Sehgewohnheiten über Bord wirft und neu herausfordert. Als größter Importeur von japanischen Manga und (Co-)Produzent von eigenen Animationsfilmen nimmt Frankreich hierbei eine besondere Rolle ein. Für den Guardian wirft Phil Hoad einen Blick auf die Geschichte und Gegenwart der französischen Japanophilie.
Was hängen blieb:
Ein kurzweiliger Artikel, der einige interessante Anekdoten enthält (beispielsweise, wie kulturkonservativer Protest zu einer Art vorauseilender Selbstzensur von Anime im französischen TV sorgte), aber auch die Schwierigkeit für ausländische Produzenten aufzeigt, einem Land wie Japan, das als „kultureller Selbstversorger“ agiert, Stoffe des eigenen Mediums schmackhaft zu machen.