Die "Feminist to Far-Right"-Pipeline, Bullys in Führungspositionen und der antidemokratische Bund Königin Luise der Weimarer Republik
Diese Woche in der Grübelkiste: Ein Videobeitrag über die “Feminist to Far-Right Pipeline” und die überparteiliche und -ideologische Mobilisierung gegen trans Menschen; ein Text über eine jüngste Statistik zur Korrelation zwischen Bully-Verhalten in der Schule und beruflichen Erfolg im späteren Leben und die Frage, inwiefern sich neoliberales Konkurrenzdenken und gesellschaftliche Nullsummenspiele überwinden lassen; und ein Podcast über den Bund Königin Luise, eine nationalistische, antidemokratische und proto-faschistische Frauenorganisation der Weimarer Republik, die zu den vergessenen Wegbereiterinnen des Nationalsozialismus zählt.
The Feminist to Far-Right Pipeline | Lily Alexandre
Um was geht es?
Spätestens das jüngste politische Auftreten von Harry Potter-Autorin J.K. Rowling hat den Begriff TERF (oder in der Selbstbezeichnung: ‘gender critical’) in den diskursiven Mainstream befördert. Sogenannte ‘trans-exclusionary radical feminists’ bezeichnen einen im Kern faszinierenden Widerspruch; radikalfeministische Kritik an starren Geschlechterordnungen trifft hier auf einen reaktionären und essentialistischen Reflex im Aufeinandertreffen mit trans Menschen. In extremen Fällen scheuen ‘genderkritische’ Feministen dabei selbst die Zusammenarbeit mit rechtsorientierten Akteuren nicht, wenn es darum geht, der ‘trans-Agenda’ einen Riegel vorzuschieben. Wie kommt es, dass Frauen, die einst legitime feministische Kritik übten, von rechts vereinnahmt werden? Youtuberin Lily Alexandre nimmt sich der Frage an.
Was hängen blieb:
Was mir am Video von Lily Alexandre gefällt, ist die offene Herangehensweise und ehrliche Auseinandersetzung mit einem Phänomen, das weniger von einer starken ideologischen Homogenität geprägt ist, sondern viel mehr von der Abwesenheit von reflektierten Weltanschauungen und einer Fokussierung auf geteilte Feindbilder. Während Lily Alexandre den theoretischen Ursprüngen des ‘trans-exclusionary feminism’ eine gewisse Progressivität im Kontext ihrer Zeit attestiert, geht es ihr vor allem um die Anfälligkeit der “nuclear middle-class family” für ein verschwörungstheoretisches Denken, das Analysen von Macht und Klasse kategorisch ausblendet und stattdessen in trans Menschen einen dankbaren Sündenbock findet. Wer zudem der festen Überzeugung ist, das feministische Projekt sei bereits abgeschlossen, der sieht in allen bestehenden gesellschaftlichen Genderstrukturen ein Gut, das es bis zum Kern zu verteidigen gilt, selbst wenn dies die Gefahr eines Rückfall in traditionelle Ordnungen miteinschließt. Lily Alexandre schließt damit, dass der Faschismus selbst nicht durch seine einheitliche Ideologie eine Gefahr darstellt, sondern durch die apolitische Einstellung und Legitimierung durch diejenigen, die seine unterdrückerischen und gewaltsamen Prozesse geschehen lassen:
“The political machine of transphobia is not rooted in a shared worldview. In fact, it was born out of a call to abandon ideology in favour of a crackdown process. Members are asked to cast aside all attachments to other principles – gender equality, civil rights – because the process of trans elimination is simply more pressing.”
From the playground to politics, it’s the bullies who rule. But it doesn’t have to be this way | The Guardian
Um was geht es?
Schaut man auf Menschen wie Elon Musk, Jeff Bezos, Donald Trump oder Javier Milei – erfolgreiche Unternehmer, populistische Galionsfiguren und in vorderster Linie abgedrehte Exzentriker unserer Zeit – dann liegt es nicht sonderlich fern, sich die Frage zu stellen, welche Typen Mensch unsere gesellschaftlichen Strukturen eigentlich produzieren und an die Spitze unserer Institutionen befördern. Eine Studie des Institute for Social and Economic Research in Essex bestätigte kürzlich einen Zusammenhang zwischen aggressivem und antisozialem Verhalten und beruflichem Erfolg im späteren Leben. Sind es also tatsächlich die Bullys, die in unserer Welt den Ton angeben? Zu dieser Frage, sowie über den befreienden Gedanken, dass ein Wandel von Organisationsstrukturen in unseren Händen liegt, macht sich George Monbiot für The Guardian Gedanken.
Was hängen blieb:
Der Text war für mich in zweifacher Hinsicht interessant. Zum einen durch seine Kritik am neoliberalen Subjekt, das durch seine selbstzentrierte Insularität ein System der Ungleichheit hervorbringt, das die Orientierung an dominantem und aggressivem Verhalten erst als notwendig erscheinen lässt. Die Formel des Nullsummenspiels, die im Text des Öfteren erwähnt wird, verweist jedoch auf den Schaden, der hierbei entsteht: “A win for bullies is a loss for everyone else”. Die Idee eines Nullsummenspiels aus konkurrierendem Interesse und begrenzten Ressourcen findet dabei nicht nur im Wettkampf zwischen Individuen Anwendung, sondern beschreibt vor allem auch geopolitische Theorieansätze klassischer Art, wie sich etwa in der Einführung von Niels Werber nachlesen lässt. Dass es von der nationalstaatlich gedachten Nullsummenaufteilung der Welt meist nur wenige Schritte hin zu einem biologistischen und rassistischen Verständnis von ‘Volk und Boden’ waren, beschreibt Werber dabei ausführlich.
Zweitens musste ich bei der Vorstellung einer meritokratischen, von Bullys besetzten Ordnung an Rutger Bregmans Buch Im Grunde gut zurückdenken, in dem er die These aufstellt, dass der Mensch im Kern ein selbst-domestiziertes, prosoziales und kooperatives Wesen ist, und die Hinwendung zum Bösen oftmals durch eine Ausnutzung von Gefühlen der Kamerad- und Schicksalsgemeinschaft, sowie durch fehlgeleitete Empathie zu erklären sei. Während der Mensch jahrtausendelang auf ein regulatives System aus Schamempfindung und prosozialem Gruppenzwang vertrauen konnte und Machtfiguren in der nomadischen Zeit einfach abzulösen waren, lassen sich die politisch kontrollierten Armeen und zivilisationsumspannenden Mythen seit Beginn der Sesshaftwerdung als möglichen Ursprung von kriegerischem Handeln begreifen. Für die Frage, wem Macht heutzutage zufällt und wie sie ausgeübt wird, ist der oben bereits erwähnte Schambegriff und die körperliche Reaktion des Errötens für Bregman zentral. Denn Studien zufolge lässt festhalten, dass diese ‘anthropologischen Konstanten’ verloren zu gehen scheinen, sobald Menschen in Machtpositionen geraten:
“[People in power] are […] more impulsive, self-centred, reckless, arrogant and rude than average, they are more likely to cheat on their spouses, are less attentive to other people and less interested in others’ perspectives. They’re also more shameless, often failing to manifest that one facial phenomenon that makes human beings unique among primates. They don’t blush.”
Der nächste Abschnitt von Bregman und der Artikel von Monbiot reichen sich damit die Hand:
“Unfortunately, there are always people who are unable to feel shame, whether because they are drugged on power or are among the small minority born with sociopathological traits. Such individuals wouldn’t last long in nomadic tribes. They’d be cast out of the group and left to die alone. But in our modern sprawling organisations, sociopaths actually seem to be a few steps ahead on the career ladder. Studies show that between 4 and 8 per cent of CEOs have a diagnosable sociopathy, compared to 1 per cent among the general population. In our modern democracy, shamelessness can be positively advantageous. Politicians who aren’t hindered by shame are free to do things others wouldn’t dare. Would you call yourself your country’s most brilliant thinker, or boast about your sexual prowess? Could you get caught in a lie and then tell another without missing a beat? Most people would be consumed by shame – just as most people leave that last cookie on the plate. But the shameless couldn’t care less. And their audacious behaviour pays dividends in our modern mediacracies, because the news spotlights the abnormal and the absurd. In this type of world, it’s not the friendliest and most empathic leaders who rise to the top, but their opposites. In this world, it’s survival of the shameless.”
Der Bund Königin Luise - Frauen für den Führer | Zeitfragen. Feature/Deutschlandfunk Kultur
Um was geht es?
Die Frage, wie die Weimarer Republik in den Faschismus führen konnte, beschäftigt Historiker:innen seit Jahrzehnten. Klar ist etwa, dass paramilitärische Strukturen bestehend aus rechtskonservativen und monarchistisch gesinnten Freikorps, die beispielsweise schon für das blutige Niederschlagen der Münchner Räterepublik verantwortlich waren, durch den laschen Umgang mit ihnen zunehmend an Einfluss gewannen. Weniger bekannt ist, welche Rolle Frauenorganisationen für die Verbreitung von Nationalismus und völkischen Faschismus in der Zeit der Weimarer Republik spielten. Für das Deutschlandfunk-Format Zeitfragen berichtet Stefanie Oswalt über den Bund Königin Luise, der in den Jahren bis zur Machtergreifung Propagandaarbeit für den entstehenden Nationalsozialismus leistete.
Was hängen blieb:
Ein nachdenklich machender Beitrag, der dem populären Vergleich von der Weimarer Republik mit unserer heutigen politischen Situation eine neue Ebene hinzufügt. Auch wenn die Gründungsgeschichte des Bundes umstritten ist, so lässt sich laut Expertin darüber nachdenken, inwiefern die historische Exkulpierung der Rolle der Frauen in Fragen der nationalsozialistischen Ideologisierung den Blick auf Schuldfragen verklärt hat. In der preußischen Königin Luise, deren Heroisierung sich nach dem Ende des ersten Weltkrieges ins nationalkonservative Lager verschob, fand der Bund eine dankbare Figur, um den Kampf für das Vaterland im Rahmen der Familie, die als “Wurzel des Staates” angesehen wurde, voranzutreiben. Der Einblick in die Satzung des Bundes offenbart zudem nicht nur dessen frühen Antisemitismus und Rassismus, sondern auch die Doppelmoral in Bezug auf das vermeintliche Ziel einer “Überbrückung der Klassenunterschiede”. Denn personell waren es vor allem Frauen aus dem Adel, die zentrale Funktionen im Bund übernahmen, während ärmere Frauen durch karitative Hilfe in den Einflussbereich der Organisation gerieten. Die Re-Organisierung des familiären Raums entlang nationalsozialistischer Wunschvorstellungen spielte sich somit zwar primär auf der geschlechtlichen Ebene ab, beinhaltete aber ganz zentral eine ökonomische und vertikale Machtdimension. Ähnlich wie im Videobeitrag zeigt sich zudem auch hier die vereinte Mobilisierungsfähigkeit bürgerlicher und rechtsextremer Kräfte, die angesichts gemeinsamer Ziele (Nationalstolz stärken, Tradition gegen liberale Kräfte bewahren, geschlechtliche Essentialisierung festigen) bereit sind, fatale über-ideologische Allianzen einzugehen.
Eine Kiste bunt Gemischtes:

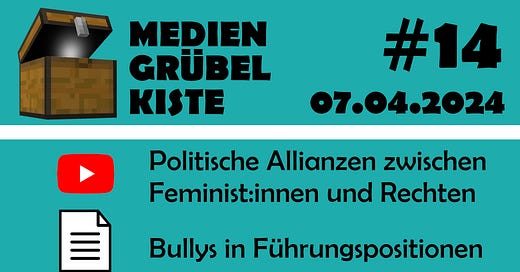


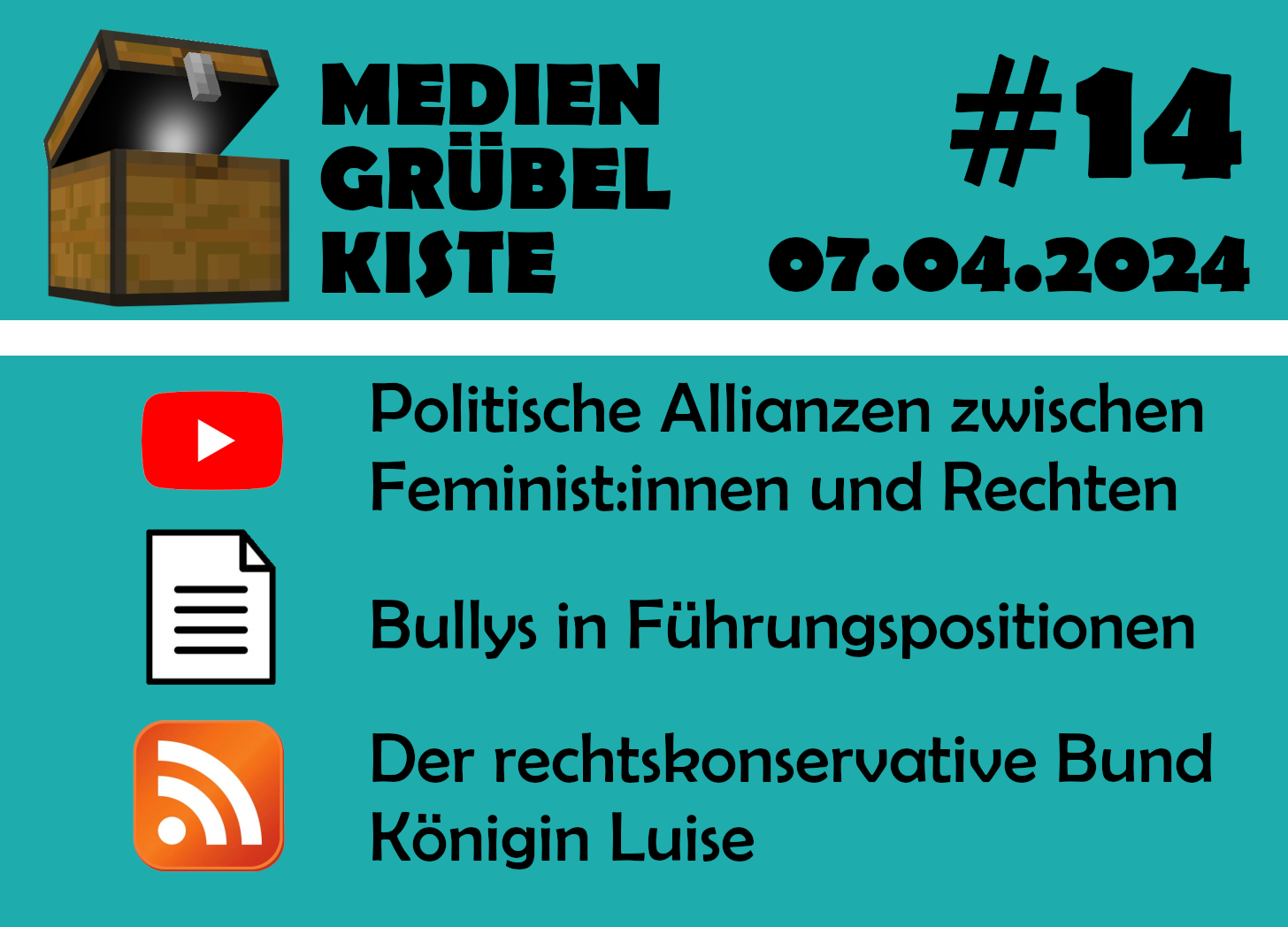
Hast du zufällig auch den Podcast von Matt Bernstein und Contrapoints über JK Rowling gehört? Da geht es auch um den Weg von TERFismus zu Faschismus. Hat für mich auch nochmal einige interessante Punkte aufgemacht.